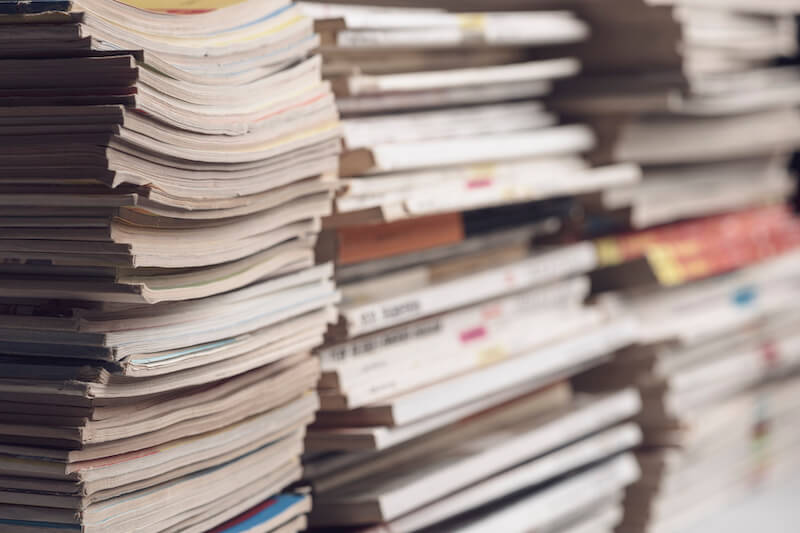
Mit einem auf Art. 9 II GG i.V.m. §§ 3 I, 17 Nr. 1 VereinsG gestützten Vereinsverbot gegen ein Presse- und Medienunternehmen darf der Schutz des Art. 5 I GG nicht unterlaufen werden. Obwohl sich COMPACT mit dem von ihm verfolgten Remigrationskonzept gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richtet, ist dies nicht für seine Tätigkeit prägend. Deshalb ist ein Verbot wegen der vorrangigen Schutzwirkung der Meinungs- und Pressefreiheit unverhältnismäßig.
A. Vereinfachter Sachverhalt
Die COMPACT-Magazin GmbH (C) gibt das monatlich bundesweit erscheinende „COMPACT-Magazin für Souveränität” heraus und ist im Internet präsent. Neben einer eigenen Webseite mit einem Onlineshop veröffentlicht C über einen YouTube-Kanal in verschiedenen Rubriken fernsehähnliche Beiträge und Videos einschließlich werktäglicher Nachrichtensendungen. Außerdem organisiert C Veranstaltungen und Kampagnen.
Im Hintergrund steht ein Eigentümerehepaar, das sich mit mehreren Mitarbeitern im Presse- und TV-Bereich zusammengeschlossen hat, um die Öffentlichkeit von ihrer politischen Meinung zu überzeugen. Die Beteiligten identifizieren sich mit dem sog. „Remigrationskonzept”, indem sie dessen Urheber, dem Österreicher S., sowohl in ihren Print- als auch Online-Medien seit Jahren ohne kritische Distanz einen breiten Raum einräumen. S wird danach bewundernd als „unser Held” bezeichnet und seine Strategie als „machbar” und „rechtsstaatlich” dargestellt.
Die vertretenen Ideen gehen u.a. von einer zu bewahrenden „ethnokulturellen Identität” aus und behandeln deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund als Staatsbürger zweiter Klasse. Gefordert wird eine „Politik der De-Islamisierung”, deshalb sollen diese Staatsangehörigen zur Remigration in ihre Herkunftsländer veranlasst werden.
Mit Verfügung vom 05.06.2024 stellte das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) unter Berufung auf das VereinsG fest, dass C sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet, deshalb verboten und aufgelöst sei. Die Verfügung wurde unter ausführlicher schriftlicher Begründung für sofort vollziehbar erklärt.
Ist die Verbotsverfügung rechtmäßig?
Welche prozessualen Mittel standen C zur Verfügung?
B. Entscheidung
Teil 1:
Rechtmäßigkeit der Verbotsverfügung
Ein Vereinsverbot kann auf der Grundlage der §§ 3 I, 17 Nr. 1 VereinsG erfolgen. Die Vorschriften lauten:
Vereinsgesetz
§ 3 Verbot
(1) Ein Verein darf erst dann als verboten (Artikel 9 Abs. 2 des Grundgesetzes) behandelt werden, wenn durch Verfügung der Verbotsbehörde festgestellt ist, dass seine Zwecke oder seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder dass er sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung richtet; in der Verfügung ist die Auflösung des Vereins anzuordnen (Verbot). …
(2) Verbotsbehörde ist….
2. das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat für Vereine und Teilvereine, deren Organisation oder Tätigkeit sich über das Gebiet eines Landes hinaus erstreckt.
§ 17 Wirtschaftsvereinigungen
Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, konzessionierte Wirtschaftsvereine nach § 22 des Bürgerlichen Gesetzbuches, Europäische Gesellschaften, Genossenschaften, Europäische Genossenschaften und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit nur anzuwenden,
1. wenn sie sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten oder….
1. Ermächtigungsgrundlage
Der belastende Verwaltungsakt des Vereinsverbots bedarf einer Ermächtigungsgrundlage, die ihrerseits die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Eingriffs regelt. Sie findet sich in § 3 I Nr. 1 i.V.m. § 17 Nr. 1 VereinsG.
a) Anwendbar auf Wirtschaftsvereinigungen
Auch wenn sich die Beteiligten zu einer GmbH zusammengeschlossen haben, steht dies der Anwendbarkeit des Vereinsgesetzes nicht entgegen. Nach § 17 Nr. 1 VereinsG findet das Gesetz auch Anwendung unter anderem auf eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Vorschrift schließt „Wirtschaftsvereinigungen” in den Anwendungsbereich des Vereinsgesetzes mit ein, wenn sie sich u. a. - worauf die Verbotsverfügung allein gestützt ist - gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten.
b) Anwendbar auf Presseunternehmen?
Der Bund hat die Gesetzgebungskompetenz im Vereinsrecht (Art. 74 I Nr. 3 GG – VereinsG), die Länder im Presse- und Medienrecht (Art. 70 GG – LPrG). Zur Abgrenzung heißt es in der Pressemitteilung des BVerwG:
„Für den vereinsrechtlichen Zugriff auf eine als Presse- und Medienunternehmen organisierte Vereinigung mangelt es zudem nicht an der Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Vielmehr entspricht die Differenzierung zwischen der verbotenen Organisation als solcher und den von ihr herausgegebenen Presse- und Medienerzeugnissen der Abgrenzung zwischen der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Vereinsrecht (Art. 74 Abs. 1 Nr. 3 GG) gegenüber der Landesgesetzgebungskompetenz für das Presse- und Medienrecht (Art. 70 Abs. 1 GG). Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Vereinsrecht, die das von einem Kollektiv ausgehende spezifische Gefahrenpotential im Blick hat, ist „blind” für den von der jeweiligen Organisation verfolgten Zweck.
Die von Art. 5 I GG gewährleistete Freiheit von Meinung, Presse und Medien steht der Anwendbarkeit des Vereinsgesetzes auf Presse- und Medienunternehmen nicht entgegen. Der Bedeutung dieser grundrechtlichen Gewährleistungen ist vielmehr bei der Rechtsanwendung im Einzelfall Rechnung zu tragen. Mit einem auf Art. 9 II GG i.V.m. § 3 I VereinsG gestützten Vereinsverbot gegen ein Presse- und Medienunternehmen darf der Schutz des Art. 5 I GG nicht unterlaufen werden.
Die Anwendung des Vereinsgesetzes auf die K erweist sich schließlich auch mit Blick auf den Gesetzeszweck als gerechtfertigt. Denn bei der Klägerin, die uneingeschränkt den Schutz der grundrechtlichen Medienfreiheiten genießt, handelt es sich nicht nur um ein Presse- und Medienunternehmen. Vielmehr verfolgt der maßgebliche Personenzusammenschluss nach seinem eigenen Selbstverständnis eine politische Agenda, organisiert Veranstaltungen sowie Kampagnen und versteht sich als Teil einer Bewegung, für die er auf eine Machtperspektive hinarbeitet.“
Gegenstand eines Vereinsverbots, das der präventiven Bekämpfung der mit dem zweckgerichteten Zusammenschluss mehrerer Personen einhergehenden Gefahren dient, ist die hinter den Medien stehende Organisation. Die verlegten Druckerzeugnisse oder Telemedien sind lediglich Mittel zur Verfolgung der Ziele, deshalb liegt der Schwerpunkt eines Verbots der GmbH als Organisation im Vereins- und nicht im Presserecht (BVerwGE 167, 293 Rn. 34-36).
2. Voraussetzungen
Die formellen Voraussetzungen nach § 3 II Nr. 2 VereinsG sind erfüllt. Da die Tätigkeit der Vereinigung länderübergreifend erfolgt, ist das Bundesministerium zuständig.
Materiell kommt es unter anderem darauf an, ob sich die Tätigkeit des C gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet. Die Schutzgüter werden entsprechend der Rechtsprechung des BVerfG zum Parteienverbot eng definiert und auf den Schutz der Menschenwürde, das Demokratieprinzip und das Rechtstaatsprinzip beschränkt.
a) Verfassungsmäßige Ordnung
Das BVerwG sieht in der Tätigkeit des Vereins einen Eingriff in diesen Schutzbereich: Dabei orientiert sich die Auslegung des Begriffs der „verfassungsmäßigen Ordnung“ an der Rechtsprechung zur „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ zu Art. 18 und Art. 21 II GG.
„Dieser schützt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Menschenwürde, das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip. Die Menschenwürde ist egalitär; sie gründet ausschließlich in der Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung, unabhängig von Merkmalen wie Herkunft, Rasse, Lebensalter oder Geschlecht. Dem Achtungsanspruch des Einzelnen als Person ist die Anerkennung als gleichberechtigtes Mitglied in der rechtlich verfassten Gemeinschaft immanent. Mit der Menschenwürde sind weder ein rechtlich abgewerteter Status noch demütigende Ungleichbehandlungen vereinbar. Dies gilt insbesondere, wenn derartige Ungleichbehandlungen gegen die Diskriminierungsverbote des Art. 3 Abs. 3 GG verstoßen.
Das ist bei dem sog. „Remigrationskonzept” der Fall, das ein Vordenker der Identitären Bewegung, Martin Sellner, entworfen hat. Diese Vorstellungen missachten - jedenfalls soweit sie zwischen deutschen Staatsangehörigen mit oder ohne Migrationshintergrund unterscheiden - das sowohl durch die Menschenwürde als auch das Demokratieprinzip geschützte egalitäre Verständnis der Staatsangehörigkeit. Denn sie gehen von einer zu bewahrenden „ethnokulturellen Identität” aus und behandeln deshalb deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund als Staatsbürger zweiter Klasse. Diejenigen, „die sich nicht assimilieren können oder wollen”, sollen zumindest durch Druck - insbesondere durch eine „Politik der De-Islamisierung” - zur „Remigration” in ihre Herkunftsländer bewegt werden.“
b) Gefährdungshandlung
§ 3 I 1 VereinsG fordert, dass sich der Verein gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung „richtet“. Ebenso wie im Parteienrecht als Voraussetzung für ein Parteienverbot (Art. 21 II GG) oder den Entzug der Parteienfinanzierung (Art. 21 III GG) interpretiert das BVerwG dieses entscheidende Merkmal eines Vereinsverbots entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts restriktiv. Danach kommt es darauf an, dass die Vereinigung „eine kämpferisch-aggressive Haltung gegenüber den elementaren Grundsätzen der Verfassung einnimmt“ (BVerfGE 149, 160 LS 3b).
Auch dieses Merkmal hat das BVerwG bezogen auf Compact laut Pressemitteilung bejaht:
„Auch wenn die die Grundüberzeugung der Vereinigung zum Ausdruck bringenden Äußerungen als solche weder strafbar noch rechtswidrig sind, können sie als Indizien für ein Vereinsverbot herangezogen werden. Dieses Instrument des präventiven Verfassungsschutzes dient dazu, frühzeitig - und ohne strafbares Handeln abwarten zu müssen - tätig werden zu können. Deshalb setzt ein Vereinsverbot mit der Voraussetzung des Sichrichtens erst an der geplanten Umsetzung der durch die Meinungsfreiheit geschützten verfassungswidrigen Vorstellungen in kämpferisch-aggressiver Weise an; Art. 9 Abs. 2 GG ist kein Weltanschauungs- oder Gesinnungsverbot. Auch das Merkmal … erfüllt K angesichts ihrer politischen Agenda und des Ziels realweltlicher Umsetzung ihrer Vorstellungen im vorpolitischen Raum.“
Damit liegen die Tatbestandsvoraussetzungen für das Vereinsverbot vor.
3. Rechtsfolge
Die Verbotsermächtigung in § 3 I VereinsG eröffnet der zuständigen Behörde Ermessen. Das Ermessen wird begrenzt durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Dabei müssen gegenläufige Grundrechte in die Abwägung mit einbezogen werden.
Das Vereinsverbot ist rechtswidrig, weil es nach Auffassung des BVerwG der Bedeutung der Pressefreiheit nach Art. 5 I GG nicht ausreichend Rechnung getragen hat:
a) Schon im Rahmen des Eilverfahrens hatte das BVerwG (Beschluss vom 14.08.2024 – BVerwG 6 VR 1.24) dazu ausgeführt:
Rn. 29 „Die Meinungsfreiheit genießt bei Kritik an staatlichen Institutionen hohes Gewicht, weil das Grundrecht gerade aus dem besonderen Schutzbedürfnis der Machtkritik erwachsen ist und darin unverändert seine Bedeutung findet (vgl. BVerfG, Beschluss vom 10. Oktober 1995 - 1 BvR 1476/91 u. a. - BVerfGE 93, 266 <293>). Über den Inhalt einer Äußerung hinaus erstreckt sich der Schutz des Art. 5 Abs. 1 GG auch auf ihre Form, so dass selbst polemische oder verletzend formulierte Äußerungen in den Schutzbereich des Grundrechts fallen (BVerfG, Beschlüsse vom 13. Mai 1980 - 1 BvR 103/77 - BVerfGE 54, 129 <138 f.> und vom 22. Juni 1982 - 1 BvR 1376/79 - BVerfGE 61, 1 <7 f.>). Insbesondere in der öffentlichen Auseinandersetzung, zumal im politischen Meinungskampf, vermittelt die Meinungs- und Pressefreiheit das Recht, auch in überspitzter Form Kritik zu äußern. Dass eine Aussage scharf und übersteigert formuliert ist, entzieht sie deshalb nicht dem Schutzbereich des Grundrechts (BVerfG, Kammerbeschluss vom 24. September 2009 - 2 BvR 2179/09 - NJW 2009, 3503 Rn. 3).
Rn. 31 Bei mehrdeutigen Äußerungen haben Behörden und Gerichte sanktionsrechtlich irrelevante Auslegungsvarianten mit nachvollziehbaren und tragfähigen Gründen auszuschließen, bevor sie ihrer Entscheidung eine zur Anwendung sanktionierender Normen führende Deutung zugrunde legen wollen (BVerfG, Beschlüsse vom 19. April 1990 - 1 BvR 40 und 42/86 - BVerfGE 82, 43 <52>, vom 9. Oktober 1991 - 1 BvR 1555/88 - BVerfGE 85, 1 <14>, vom 13. Februar 1996 - 1 BvR 262/91 - BVerfGE 94, 1 <9> und vom 25. Oktober 2005 - 1 BvR 1696/98 - BVerfGE 114, 339 <349>). Entgegen der Annahme der Antragsgegnerin ist diese Interpretationsmaxime bei der Auslegung von Äußerungen auch im Rahmen der Überprüfung eines gegenüber einem Presse- und Medienunternehmen ausgesprochenen Vereinsverbots zugrunde zu legen. Denn andernfalls könnte - entgegen der verfassungsgerichtlichen Vorgaben (BVerfG, Beschluss vom 13. Juli 2018 - 1 BvR 1474/12 u. a. - BVerfGE 149, 160 Rn. 93, 98 und 113) - der Schutz der Pressefreiheit durch ein Vereinigungsverbot unterlaufen werden. Deshalb ist bei mehrdeutigen Äußerungen diejenige Variante zugrunde zu legen, die noch von der Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt ist. Insoweit ist bei der Auslegung von Äußerungen, die einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung leisten, mit Blick auf das Gewicht des Grundrechts der Meinungsfreiheit in Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG und die grundsätzliche Vermutung für die Freiheit der Rede in der liberalen Demokratie nicht engherzig zu verfahren (BVerwG, Urteil vom 30. November 2022 - 6 C 12.20 - BVerwGE 177, 190 Rn. 61).“
b) An dieser Einschätzung hält das BVerwG auch in der Hauptsache fest kommt deshalb zum Ergebnis, dass die Verbotsverfügung unverhältnismäßig ist.
„Das Grundgesetz garantiert jedoch im Vertrauen auf die Kraft der freien gesellschaftlichen Auseinandersetzung selbst den Feinden der Freiheit die Meinungs- und Pressefreiheit. Es vertraut mit der Vereinigungsfreiheit grundsätzlich auf die freie gesellschaftliche Gruppenbildung und die Kraft des bürgerschaftlichen Engagements im freien und offenen politischen Diskurs. Deshalb ist ein Vereinsverbot mit Blick auf das das gesamte Staatshandeln steuernde Prinzip der Verhältnismäßigkeit nur gerechtfertigt, wenn sich die verfassungswidrigen Aktivitäten für die Vereinigung als prägend erweisen.
In der Gesamtwürdigung erreichen die verbotsrelevanten Äußerungen und Aktivitäten noch nicht die Schwelle der Prägung. Diese Überzeugung hat sich der Senat durch die Sichtung und Würdigung des umfangreichen Materials aus den COMPACT-Medien und weiteren … Unterlagen verschafft. Dabei war bei der Deutung von Äußerungen zum Schutz der der Klägerin zustehenden Meinungsfreiheit die Bandbreite möglicher Aussagegehalte zu berücksichtigen.
Eine Vielzahl … migrationsfeindlicher Äußerungen lässt sich danach auch als überspitzte, aber letztlich im Lichte der Kommunikationsgrundrechte zulässige Kritik an der Migrationspolitik deuten….“
Zwischenergebnis
Die Verbotsverfügung ist unverhältnismäßig und damit rechtswidrig.
Teil 2:
Rechtsschutz
Der Verwaltungsrechtsschutz ist der § 40 I VwGO eröffnet. Sachlich zuständig zur Entscheidung über ein Versammlungsverbot des Bundesinnenministeriums ist sowohl im Hauptsacheverfahren als auch im Eilverfahren das BVerwG (§ 50 I Nr. 2 VwGO).
1. Hauptsache
Im Hauptsacheverfahren ist eine Anfechtungsklage, gerichtet auf Aufhebung der Verbotsverfügung durch das BVerwG, statthaft (§ 42 I VwGO).
2. Eilverfahren
Der vorläufige Rechtsschutz richtet sich nach § 80 V VwGO als lex specialis zu § 123 I VwGO (vgl. § 123 V VwGO). Wenn die Anordnung der sofortigen Vollziehung formal ordnungsgemäß erfolgt ist (vgl. dazu § 80 III 1 VwGO), ist der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen die Verbotsverfügung gerichtet.
(BVerwG vom 24.06.2025 – BVerwG 6 A 4.24 und vom 14.08.2024 – BVerwG 6 VR 1.24)
Stand der Rechtsprechung zu Verboten und Beschränkungen zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung
Die Rechtsprechung zur Zulässigkeit
Beobachtung verfassungsfeindlicher Parteien,
der Einschränkung der Parteienfinanzierung,
Parteienverbots und
Vereinigungsverbots
lässt sich auf wenige Grundlinien konkretisieren. Entscheidend ist die erforderliche Gefährdungshandlung, deren Intensität bei der Beobachtung am geringsten, beim Parteienverbot am höchsten ist. Die Einschränkung der Finanzierung von Parteien und das Verbot verfassungsfeindlicher Vereinigungen gehen von einer nahezu identischen Gefährdungslage aus.
1. Gemeinsame Voraussetzung: Schutzgüter
Schutzgüter sind die freiheitlich demokratische Grundordnung und der Bestand der Bundesrepublik. Wegen des Ausnahmecharakters des Art. 21 GG gehören zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung nur zentrale Grundbegriffe und damit die Menschenwürde, das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip.
Die Menschenwürde umfasst die Wahrung der personalen Individualität, Identität und Integrität sowie die elementare Rechtsgleichheit. Sie ist egalitär und damit unabhängig vom Merkmal der Herkunft, Rasse, dem Lebensalter oder dem Geschlecht. Eine Ideologie, die auf eine Ausgrenzung von Ausländern aus dem öffentlichen Leben und auf eine Einschränkung gleichberechtigter Wahrnehmung politischer Rechte durch Ausländer auch nach ihrer Einbürgerung gerichtet ist, ist mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung nicht vereinbar.
Zur Demokratie gehört die gleichberechtigte Teilhabe aller Bürger am Prozess der politischen Willensbildung und die Rückkopplung staatlicher Organe an das Volk. Schließlich zählt zum (reduzierten) Schutzumfang auch das Rechtsstaatsprinzip mit Gewaltenteilung und gerichtlicher Kontrolle staatlichen Handelns.
2. Gefährdungshandlungen
a) Beobachtungverfassungsfeindlicher Parteien
Da sich die Beobachtung und Einordnung einer Partei als Verdachtsfall im „unteren Bereich“ der möglichen Belastungen der Parteien zum Schutz der fdGO bewegen, fordert das OVG Münster (Urteil vom 13.05.2024 – 5 A 1216/22 zitiert nach juris Rn. 161):
„Das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte im Sinn von § 4 Abs. 1 Satz 5 BVerfSchG setzt nicht voraus, dass verfassungsfeindliche Bestrebungen tatsächlich bestehen, und verlangt auch keine Gefahrenlage im Sinn des Polizeirechts. Andererseits sind bloße Vermutungen, Spekulationen oder Hypothesen, die sich nicht auf beobachtbare Fakten stützen können, unzureichend. Die Anhaltspunkte müssen vielmehr in Form konkreter und hinreichend verdichteter Umstände als Tatsachenbasis geeignet sein, den Verdacht verfassungsfeindlicher Be-strebungen zu begründen.“
b) Einschränkung der Parteienfinanzierung
Sowohl für Art. 21 II (Parteienverbot) als auch für Art. 21 III GG (Finanzierung) kommt es darauf an, dass die Partei ihre Ziele zur Beseitigung oder Beeinträchtigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung durch ein aktives, planmäßiges Handeln anstrebt. Vertritt eine Partei lediglich staatsfeindliche Meinungen, reicht dies nicht aus. Konsequenz ist, dass sowohl für ein Parteienverbot als auch für die Einstellung der Finanzierung ein qualifiziertes (systematisches) Handeln der Art erforderlich ist, dass die betroffene Partei über das „Bekennen” ihrer verfassungsfeindlichen Ziele hinaus die Grenze zum „Bekämpfen” der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes des Staates überschreiten muss.
Für das Verbot der Finanzierung kommt es darauf an, dass einerseits (subjektiv) ein Über-schreiten der Schwelle zur Bekämpfung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes der Bundesrepublik Deutschland erreicht ist, während es objektiv nicht auf die Potenzialität der Gefährdung ankommt (Art. 21 III GG: „darauf ausgerichtet“). Rechtfertigung ist, dass der freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat diejenigen, die aktiv auf seine Beeinträchtigung oder Beseitigung hinwirken, nicht auch noch die (finanziellen) Mittel hierfür an die Hand geben soll (BVerfG vom 23.01.2024 – 2 BvB 1/19 Rn. 291).
c) Vereinigungsverbot
Vergleichbar fordert § 3 I 1 VereinsG, dass sich der Verein gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung „richtet“. Danach kommt es darauf an, dass die Vereinigung „eine kämpferisch-aggressive Haltung gegenüber den elementaren Grundsätzen der Verfassung einnimmt“ (BVerfGE 149, 160 LS 3b). „Darauf ausgerichtet“ und gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung gerichtet sind vergleichbarer Begriffe.
d) Parteienverbot
Ein Parteienverbot kommt nur in Betracht, wenn das vorstehend beschriebene Handeln einer Partei auch erfolgreich sein könnte (Art. 21 II GG: „darauf ausgehen“). Es bedarf deshalb einer potentiellen Gefahr und damit einer objektiven Wahrscheinlichkeit, dass die verfassungsmäßige Ordnung in der Bundesrepublik Schaden nehmen kann. Dies hat das BVerfG zB im NPD-Verbotsverfahren (Urteil vom 17.01.2017 – 2 BvB 1/19, Rn. 285) verneint – wegen der Bedeutungslosigkeit der Partei mit einem ganz geringen Stimmanteil bei den Wählern.

Du möchtest weiterlesen?
Dieser Beitrag steht exklusiv Kunden von Jura Online zur Verfügung.
Paket auswählen