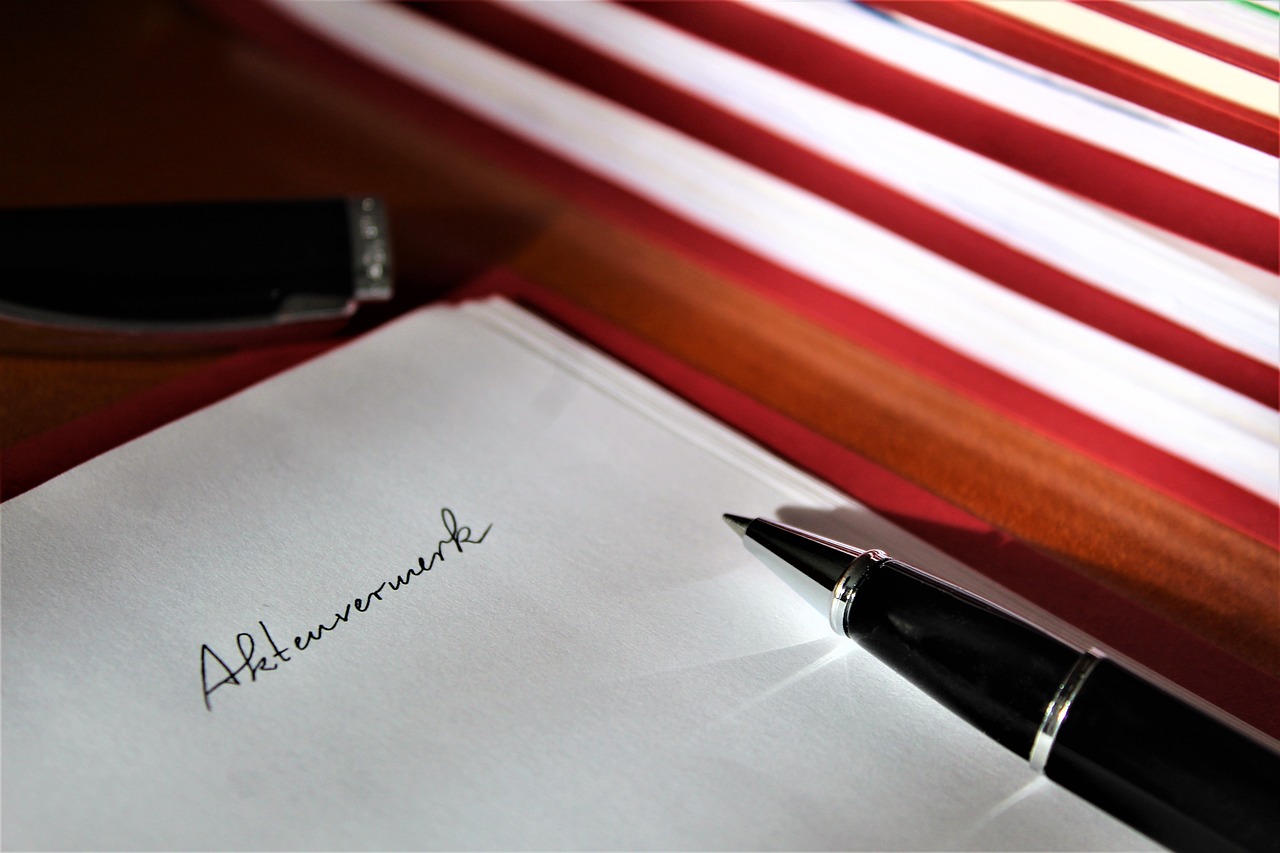
Zurück zu antiliberalen Verhältnissen der 70er Jahre?
Am heutigen Mittwoch beginnt in Eisenach die Justizministerkonferenz - ein wichtiges Forum für neue Ideen und Innovationen auf dem Gebiet der Rechtspolitik, das der Koordination und Abstimmung der justiz- und rechtspolitischen Vorhaben der Länder dient. Neue Ideen bringt insbesondere Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) ein: Sie fordert, dass Richter in Zukunft bundesweit vor ihrer Einstellung vom Verfassungsschutz überprüft werden sollen.
Worum geht es?
Bei den langwierigen Verhandlungen unserer aktuellen Bundesregierung ist im Rahmen des Koalitionsvertrages mit einem “Pakt für den Rechtsstaat” unter anderem verabredet worden, die Justiz und die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern zu stärken. Hierfür soll insbesondere zusätzliches Personal eingestellt werden. Ein solches Vorhaben bedürfe aber entsprechender Vorkehrungen, um die staatlichen Strukturen vor extremistischem Gedankengut in einer Zeit wachsender extremistischer Bedrohung zu bewahren, sagt Kühne-Hörmann. Daher soll in Zukunft die Verfassungstreue angehender Richter bundesweit überprüft werden. Ziel des hessischen Vorschlags ist eine sogenannte Regelabfrage beim jeweiligen Landesamt für Verfassungsschutz. Damit soll geklärt werden, ob bei Bewerbern für das Richteramt Anhaltspunkte für mögliche verfassungsfeindliche Einstellungen und Aktivitäten vorliegen. Hessen orientiert sich damit am Vorbild Bayerns, das eine solche Regelabfrage bereits seit Ende 2016 bei jeder Einstellung eines angehenden Richters oder Staatsanwalts praktiziert: So würden alle von einer Bewerbung in Bayern abgeschreckt, die nicht jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten, sagt Bayerns Landesjustizminister Winfried Bausback (CSU).
Erzwungene Zustimmung?
Die Regelabfrage stößt in anderen Bundesländern aber auf Kritik: Hessen falle damit in antiliberale Verhältnisse der 70er Jahre zurück, sagt Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grünen). Gemeint ist damit der im Jahr 1972 in Kraft getretene sogenannte Radikalenerlass, der die Beschäftigung von Links- und Rechtsextremisten im öffentlichen Dienst verhindern sollte und sich auch auf bereits beschäftigte Personen erstreckte. Der Erlass führte zu millionenfachen Überprüfungen und wurde vier Jahre später wieder abgeschafft. Die Folgen der damals ausgesprochenen Berufsverbote seien noch heute in den Rentenbiografien verhinderter Lehrer zu spüren. Zudem ziehe die Regelabfrage die Verfassungstreue der Bewerber grundsätzlich in Zweifel: Damit die Überprüfung überhaupt stattfinden kann, muss der Bewerber hierzu zwar auch einwilligen - dem Richterwahlausschuss werde allerdings ein etwaiges “Nein” mitgeteilt. Die Bewerber seien somit zur Überprüfung gezwungen.
Besondere Gefahren für das Richteramt
Hessen sieht hierin jedoch keinen Generalverdacht gegen potenzielle Richter, sondern eine Möglichkeit, Mitglieder rechts- oder linksextremer oder islamistischer Gruppen im Vorfeld auszufiltern. In dem zu überprüfenden Papier des hessischen Landesjustizministeriums heißt es hierzu: “Die Gefahren durch den Links- und Rechtsextremismus sowie aufgrund islamistischer Terrorbedrohungen nehmen europaweit und auch in Deutschland zu. Es häufen sich Fälle, in denen verfassungsfeindliche Männer und Frauen nicht nur in die Beamtenschaft, sondern in den gesamten öffentlichen Dienst drängten. Dies birgt im Hinblick auf das Richteramt besondere Gefahren.“ Auf der Konferenz wird nun zu diskutieren sein, ob sich der Antrag durchsetzt. In Bayern soll die Regelabfrage seit ihrer Einführung im November 2016 keinen einzigen Treffer, sondern nur Fehlanzeigen ergeben haben.

Du möchtest weiterlesen?
Dieser Beitrag steht exklusiv Kunden von Jura Online zur Verfügung.
Paket auswählen